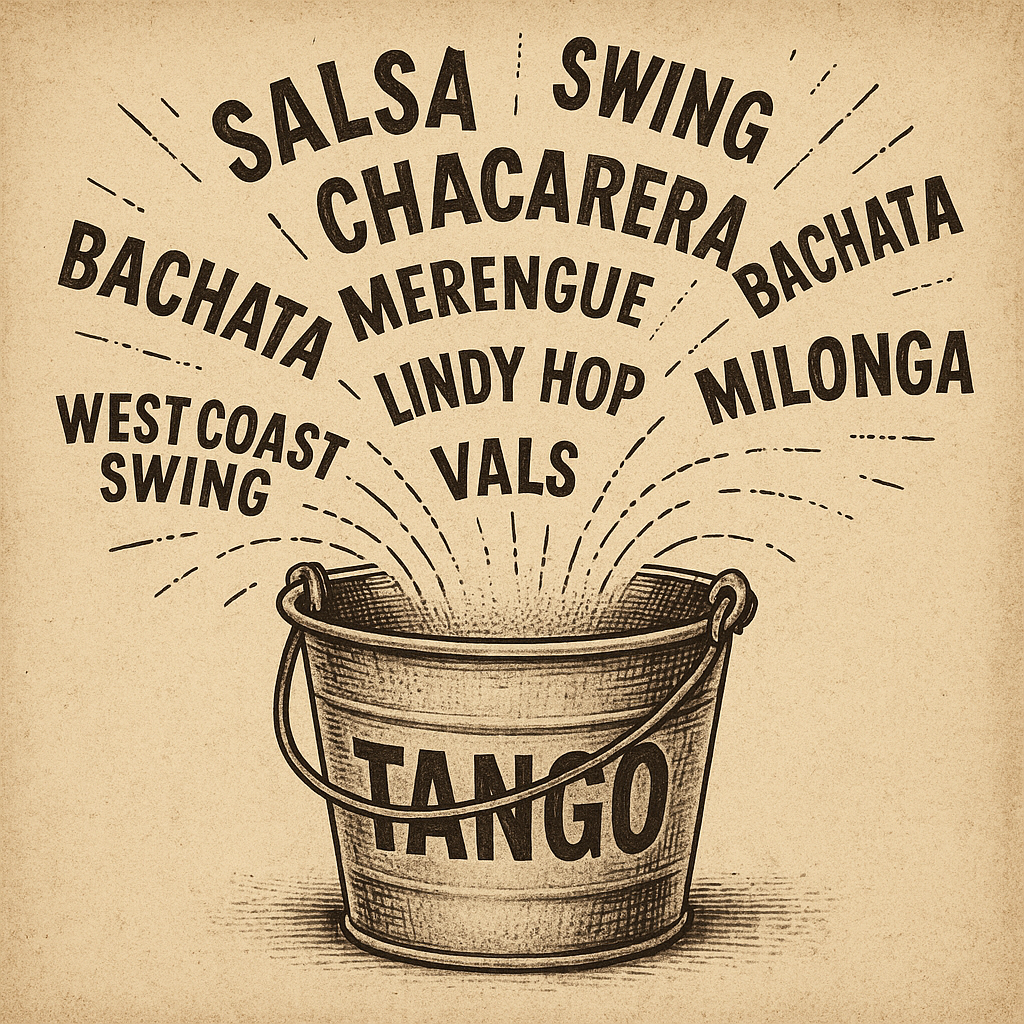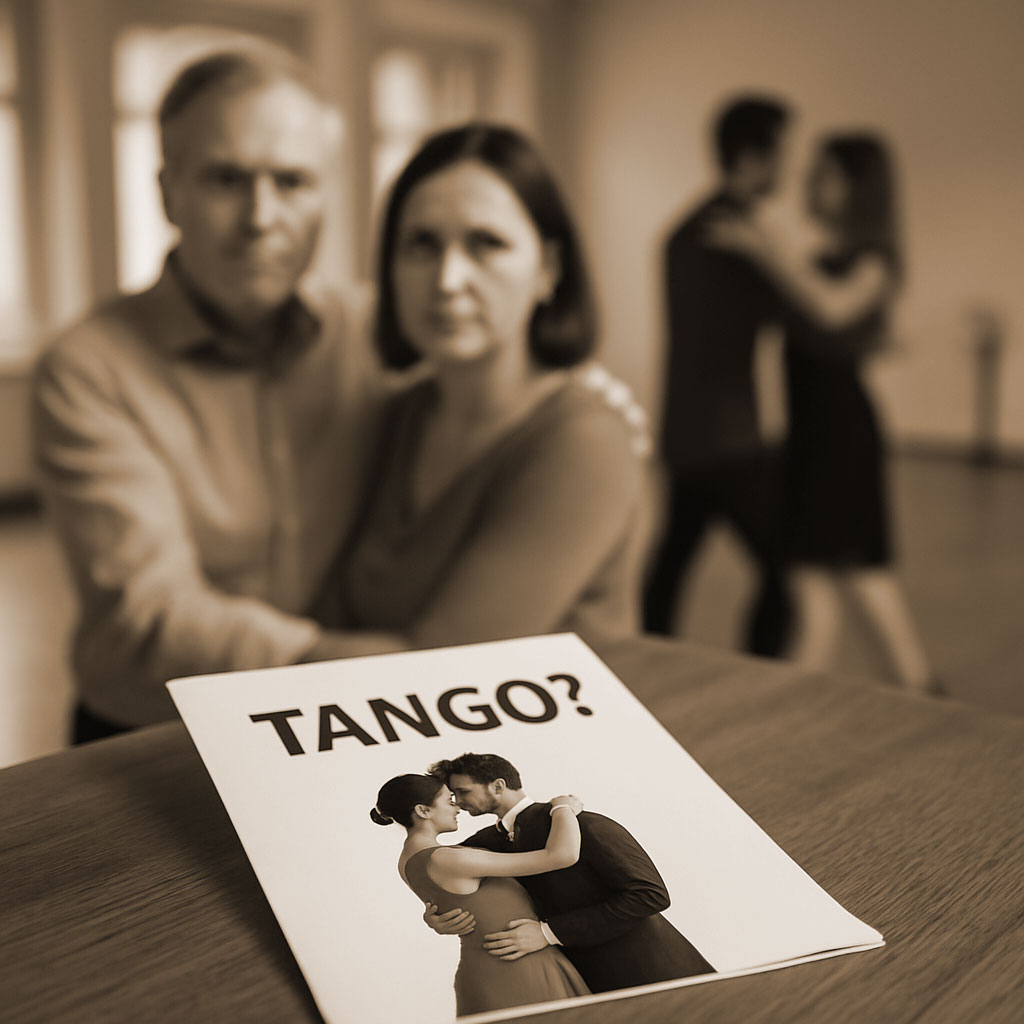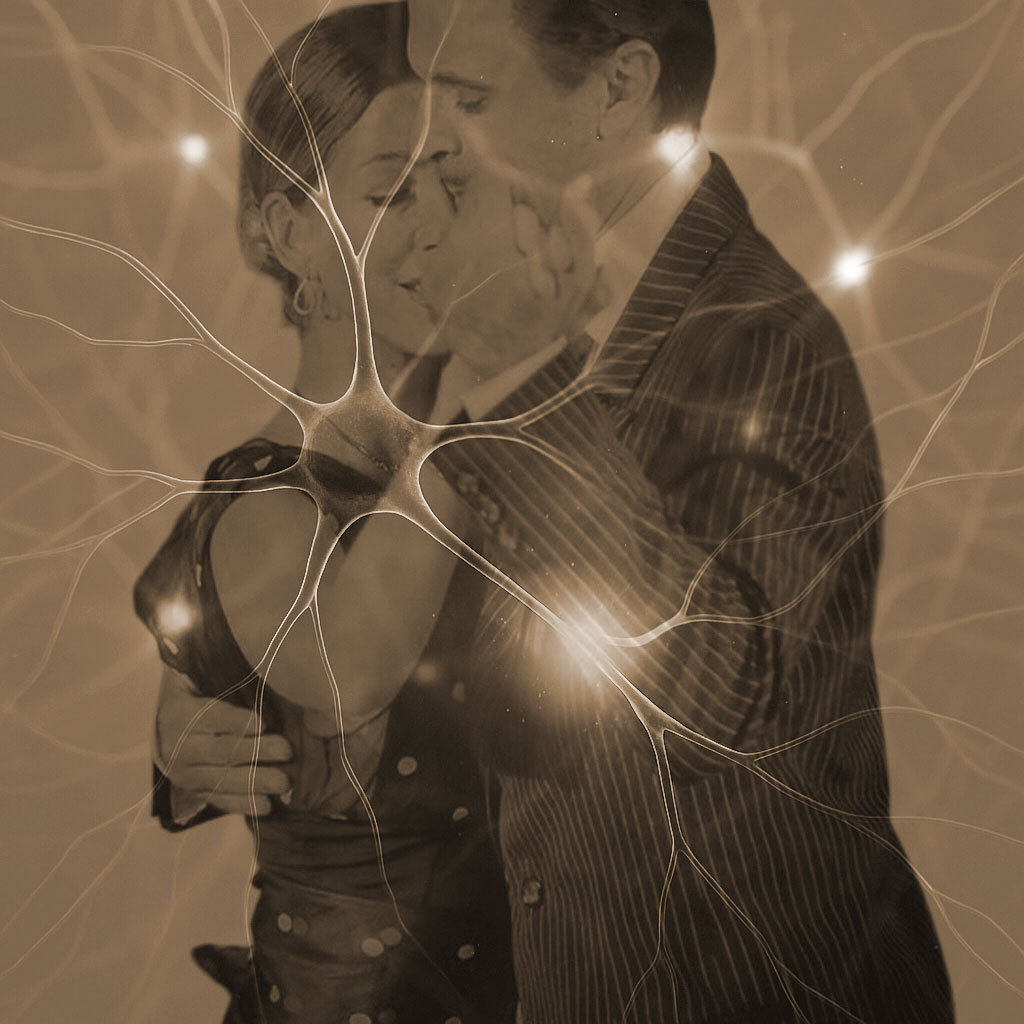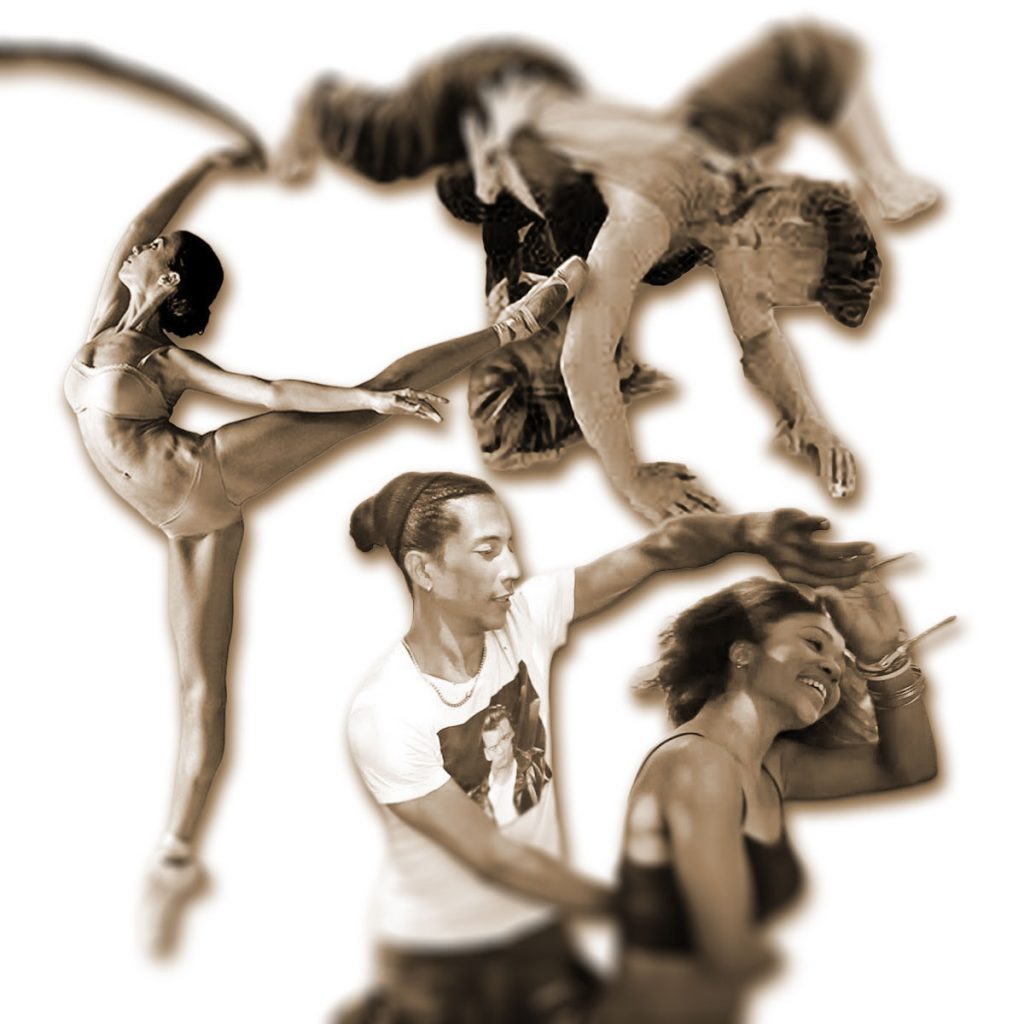Ein kleines Resümee • eine Rückschau und Reflexion Das ist nun der 30. Teil der Reihe „Gedanken über Tango-Unterricht“ – eigentlich waren es mehr, weil manche Themen mehrere Teile hatten. Zeit also, mal ein kleines Resümee zu ziehen. Ehrlich gesagt, haben mich manchmal die Diskussionen mit anderen Bloggern oft mehr Energie gekostet als die inhaltliche Arbeit an Tango-Themen selbst. Die vorübergehende „Beheimatung“ einiger Kommentatoren, die bei Gerhard Riedl geblockt wurden und dann bei mir schrieben, hat zwar ordentlich Traffic gebracht […]