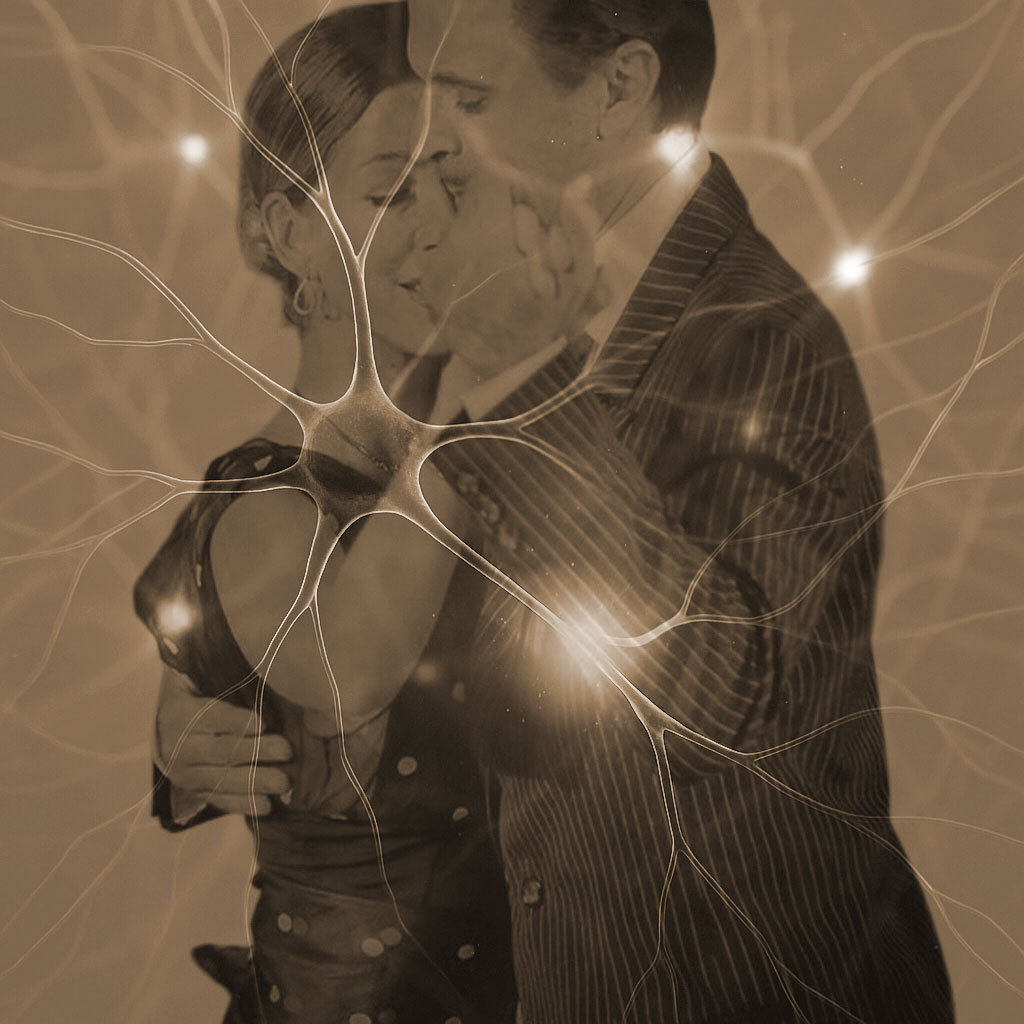
Gedanken über Tango Unterricht | 28. Teil
Der Tanz der Neuronen – über Gewohnheit, Geduld und Veränderung im Tango
Gewohnte Bewegungsmuster und das Lernen im Tango
Im Unterricht zeigt sich oft, wie schwierig es ist, gewohnte Bewegungsmuster zu verändern oder zu verbessern. In der Neurobiologie spricht man in diesem Zusammenhang vom Prinzip „strong fire – strong wire“: Häufig gleichzeitig aktivierte Nervenzellen bilden verstärkte synaptische Verbindungen – ein Prozess, der als Hebb’sches Lernen bekannt ist. Dadurch verfestigen sich bestimmte neuronale Netzwerke, die Bewegungen automatisieren und ökonomisieren, aber auch deren Veränderung erschweren. Diese tief eingeprägten Bewegungsabläufe lassen sich daher nur schwer umstrukturieren. Gerade im Tango-Unterricht wird deutlich, dass es nahezu aussichtslos ist, grundlegende Bewegungen zu verändern oder zu verbessern, ohne die geduldige und beharrliche Mitarbeit der Lernenden. Nur durch kontinuierliche Aufmerksamkeit, Wiederholung und gezielte Variation können neue, funktionalere Muster entstehen – ein Vorgang, der unter dem Begriff neuronale Plastizität beschrieben wird.
Zwischen Fortschritt und Rückfall
Wir Tangolehrer kennen es nur zu gut: Man hat in der letzten Unterrichtsstunde ein Basisthema wie etwa „das Gehen“erfolgreich vermittelt – die Haltung stimmte, das Gewicht war klar, die Schritte flossen. Doch am nächsten Kursabend scheint jeder Fortschritt wie weggeblasen: Alle tanzen sich wieder in ihren alten Mustern ein, als hätte das Neue nie stattgefunden.
Natürlich ist mir bewusst, dass viele Lernende sich beim Eintanzen zunächst in ihren gewohnten Bewegungsmusternorientieren. Erst durch gezielte Hinweise und bewusste Aktivierung der im Vorfeld erarbeiteten Veränderung können sie das zuvor Erreichte wieder abrufen. Dieses Phänomen ist also kein Zeichen mangelnder Aufmerksamkeit, sondern Ausdruck einer tief gespeicherten sensomotorischen Gewohnheit, die sich im prozeduralen Gedächtnis verankert hat.
Mentales Aufwärmen im Tango
Ein praktischer Ansatz im Unterricht besteht darin, die Tänzerinnen und Tänzer bereits vor dem Eintanzen dazu anzuleiten, sich bewusst an das Thema und die Fortschritte der letzten Stunde zu erinnern. Diese kurze mentale Aktivierung ruft die entsprechenden neuronalen Netzwerke wieder ins Bewusstsein und erleichtert den Übergang vom Alltagsmodus in das spezifische Bewegungslernen. So wird das Eintanzen nicht nur ein körperliches, sondern auch ein kognitives Aufwärmen – eine bewusste Rückkehr in den zuvor erarbeiteten Lernzustand.
Lernen durch Variation und Bewusstheit
Bewegungsmuster sind gespeicherte Netzwerke, auf die das Gehirn in Momenten von Unsicherheit oder Ablenkung automatisch zurückgreift. Aus lerntheoretischer Perspektive spricht man hier von einer Regression auf etablierte motorische Schemata. Für Lehrende bedeutet das, Lernprozesse als langfristige Reorganisation motorischer Netzwerke zu verstehen. Beharrlichkeit ist unerlässlich – doch ebenso wichtig ist es, die Wiederholung didaktisch kreativ und kontextsensibel zu gestalten, um Monotonie zu vermeiden.
Die Forschung zum motorischen Lernen zeigt, dass Variation ein entscheidender Faktor für nachhaltigen Lernerfolg ist. Bewegungen können mit unterschiedlicher Musik, variierendem Tempo oder wechselndem Partner geübt werden. Diese kontextuelle Interferenz fördert die neuronale Flexibilität und führt dazu, dass neue Bewegungsmuster stabiler abrufbar werden. Auch das bewusste Wahrnehmen kleinster Veränderungen – etwa im Gleichgewicht, in der Muskelspannung oder in der Partnerkommunikation – unterstützt die Bildung neuer sensorisch-motorischer Verschaltungen.
Ebenso bedeutsam ist die kognitive Einbettung des Übens: Wenn Lernende verstehen, warum eine Bewegung auf eine bestimmte Weise effizienter oder ästhetischer ist, steigt die intrinsische Motivation. So wird aus Wiederholung kein bloßes „Drill“, sondern ein Prozess der bewussten Selbstbeobachtung und Anpassung. Kleine Erfolgserlebnisse, reflektierte Wahrnehmung und spielerische Elemente fördern die Ausschüttung dopaminerger Belohnungssignale, was wiederum die Konsolidierung neuer neuronaler Verbindungen begünstigt.
Auf diese Weise verwandelt sich das mühsame „Umlernen“ in einen lebendigen Prozess der neuro-motorischen Exploration – oder, poetisch gesprochen: in einen Tanz zwischen Bewusstsein und Bewegung.
Zwischen Hartnäckigkeit und Motivation
Guter Unterricht ist das eine – doch ohne die aktive Mitarbeit der Lernenden bleibt selbst der beste didaktische Ansatz wirkungslos. Bewegung lässt sich nicht „vermitteln“ wie theoretisches Wissen; sie muss von innen heraus erfahren und gestaltet werden. Gerade im Tango, wo jede Bewegung aus Wahrnehmung, Balance und Beziehung entsteht, ist diese innere Beteiligung entscheidend.
Doch wie gelingt es, dass Lernende wirklich mitarbeiten – aus eigenem Antrieb, nicht nur auf Aufforderung?
Ein Schlüssel liegt in der gemeinsamen Verantwortung für den Lernprozess. Wenn Schüler verstehen, dass Veränderung kein äußerer Befehl, sondern ein eigener Erfahrungsprozess ist, verändert sich ihre Haltung: Sie werden zu aktiven Mitgestaltern. Fragen wie „Wie hat sich das eben angefühlt?“, „Was verändert sich, wenn du dein Gewicht bewusster verlagerst?“ oder „Wie reagiert dein Partner auf diese Bewegung?“ lenken die Aufmerksamkeit weg von der bloßen Korrektur hin zur Selbstwahrnehmung – dem Kern jedes nachhaltigen Lernens.
Hartnäckigkeit im Unterricht bedeutet in diesem Sinne nicht Strenge, sondern konsequente Präsenz. Sie zeigt sich darin, dass wir als Lehrende das Ziel klar im Blick behalten, ohne den Lernweg zu erzwingen. Geduld, Humor und Empathie verwandeln Beharrlichkeit in eine Form von Verlässlichkeit – Lernende spüren dann nicht Druck, sondern Begleitung.
Es hilft, den Unterricht als gemeinsames Forschungsfeld zu begreifen: Jeder Versuch, jede Korrektur, jedes Stolpern gehört zum Prozess. Wenn Lehrende authentisch interessiert bleiben, entsteht eine Atmosphäre, in der Neugier wichtiger ist als Perfektion.
Denn letztlich ist Lernen im Tanz immer auch Beziehungsarbeit – zwischen Lehrer und Schüler, zwischen Körper und Bewusstsein, zwischen Gewohnheit und Möglichkeit. Wenn es gelingt, diese Beziehung lebendig zu halten, wird Hartnäckigkeit nicht als Nerven empfunden, sondern als Einladung, dranzubleiben.
Quereinsteiger und die Kunst der Integration
Immer wieder gibt es im Unterricht diese spezielle Herausforderung: Quereinsteiger aus anderen Tangoschulen. Manche tanzen schon seit Jahren, sind neugierig auf was Neues – bringen aber auch ein gutes Stück Gewohnheit und manchmal festgefahrene Vorstellungen mit. Viele sind es gewohnt, dass im Unterricht jede Woche eine neue Figur kommt, und wenn man dann an Haltung, Achse oder am Gehen arbeitet, wirkt das für sie erstmal wie ein Rückschritt.
Oft höre ich dann Sätze wie:
„Aber mein Lehrer hat das ganz anders erklärt.“
„Bei uns hat das immer so funktioniert.“
Solche Kommentare sind nicht böse gemeint. Sie zeigen einfach, dass jemand sich orientieren will – und das Bekannte gibt nun mal Sicherheit. Wenn dann plötzlich jemand kommt und sagt: „Wir fangen nochmal beim Gehen an“, ist das für viele erstmal ein kleiner Schock. Das, was wie Widerstand aussieht, ist in Wahrheit oft nur Verunsicherung.
Anerkennen, was da ist
Ich habe gelernt: Am besten fahre ich, wenn ich das, was jemand mitbringt, anerkenne, statt dagegenzuhalten. Jeder hat seine eigene Lerngeschichte – und auch wenn ich mit manchen Methoden nicht übereinstimme, sind sie doch Teil dieser Geschichte. Ich sage dann zum Beispiel:
„Spannend, dass du das so gelernt hast. Ich zeige dir heute mal einen anderen Zugang – probier einfach, wie sich das anfühlt.“
Das öffnet eine Tür. Es geht nicht darum, recht zu haben, sondern eine neue Erfahrung möglich zu machen.
Basics neu rahmen
Gerade Quereinsteiger empfinden Basics oft als langweilig oder überflüssig. Ich versuche, das umzudrehen:
„Die Grundlagen sind das, was dir später Freiheit gibt. Wenn die Achse stimmt und dein Schritt stabil ist, kannst du alles tanzen, was du willst.“
So werden Basics nicht als Rückschritt erlebt, sondern als Weiterentwicklung. Viele merken dann, dass kleine Veränderungen eine riesige Wirkung haben – und genau da fängt echtes Lernen an.
Weniger reden, mehr spüren
Ich habe aufgehört, über Unterschiede zwischen „meiner“ und „anderer“ Methodik zu diskutieren. Das bringt niemanden weiter. Stattdessen lasse ich die Leute fühlen, was ich meine.
„Mach’s mal so, wie du’s kennst, und dann probier mal meine Variante. Spür einfach den Unterschied.“
Wenn der Körper selbst merkt, dass etwas leichter, klarer oder stabiler wird, ist die Sache geklärt – ganz ohne Diskussion.
Die Gruppe als Lehrerin
In bestehenden Gruppen hilft es, Quereinsteiger erstmal mit Leuten zusammenzubringen, die meinen Unterrichtsstil schon kennen. Die Gruppe trägt dann automatisch mit – sie zeigt durch Haltung, Aufmerksamkeit und Sprache, worauf es ankommt. Das wirkt viel stärker als jede Erklärung von mir.
Dranbleiben ohne Druck
Und natürlich braucht das Ganze Geduld. Manchmal dauert es, bis jemand wirklich loslässt, was er gewohnt ist. Ich bleibe dann freundlich, klar und beharrlich. Ich will nicht „recht haben“, ich will, dass jemand fühlt, was besser funktioniert. Wenn das passiert, ist alles gewonnen.
Quereinsteiger zu integrieren heißt also nicht, sie „umzuprogrammieren“. Es heißt, eine gemeinsame Sprache zu finden. Wenn das gelingt, wird aus unterschiedlichen Lerngeschichten kein Chaos, sondern ein spannender Austausch – und am Ende tanzen alle im gleichen Fluss, nur jeder auf seine Weise.
Die Aufmerksamkeit auf die Musik lenken
Immer wieder sehe ich es im Unterricht: Wenn die Aufmerksamkeit zu sehr auf die Technik gerichtet ist, bleibt das Tanzen auf der Strecke. Natürlich brauchen wir Technik – sie ist das Werkzeug, mit dem wir uns bewegen, kommunizieren und ausdrücken. Aber wenn sich alles nur noch um die richtige Haltung, das saubere Gehen oder die perfekte Achse dreht, dann wird der Tango schnell trocken, leer und verkrampft.
Ich sage oft im Unterricht:
„Technik ist wichtig – aber sie ist nicht das Ziel, sondern das Mittel.“
Viele Tänzer verlieren das Gefühl für den Moment, weil sie beim Tanzen innerlich Fehlerlisten abhaken: „Bin ich auf der Achse? Ist mein Knie gestreckt? Bin ich im Takt?“
Dabei geht die eigentliche Magie verloren – das Hören, das Reagieren, das Miteinander-Schwingen.
Technik ohne Musik ist tot
Wenn jemand nur auf seine Schritte achtet, hört man das sofort. Der Tanz wirkt eckig, kontrolliert, manchmal fast steril. Erst wenn der Körper auf die Musik antwortet, entsteht dieser lebendige Dialog, der Tango wirklich ausmacht. Ich sage manchmal scherzhaft:
„Euer Körper darf auch mal früher tanzen als euer Kopf.“
Musik ist kein Hintergrund, sie ist die Grundlage. Alles, was wir technisch üben – Gehen, Ochos, Pivots, Pausen – macht nur dann Sinn, wenn es in Beziehung zur Musik steht. Ohne Musik ist Technik wie ein Satz ohne Bedeutung.
Die Musik als Lehrer
Ich lade meine Schüler oft ein, einfach zu stehen und zuzuhören. Nicht gleich tanzen, nur hören: den Rhythmus, die Spannung, das Atmen zwischen den Takten. Wenn man das wirklich zulässt, bewegt sich der Körper irgendwann von selbst. Die Musik zieht einen, man „denkt“ nicht mehr, man folgt.
Ich sage dann gern:
„Lass die Musik die Führung übernehmen. Sie zeigt dir, wann Bewegung Sinn macht und wann Stille schöner ist.“
Diese Momente sind oft die magischsten im Unterricht. Plötzlich tanzen die Schüler anders – entspannter, natürlicher, echter.
Balance zwischen Technik und Gefühl
Natürlich darf das Pendel nicht ganz auf die andere Seite ausschlagen. Wer die Technik völlig ignoriert, verliert Klarheit und Kommunikation. Aber die Kunst liegt genau in der Balance: Die Technik soll unterstützen, nicht dominieren.
Wenn sie im Körper verankert ist, darf sie in den Hintergrund treten. Dann bleibt Raum für Ausdruck, Musikalität und Verbindung.
Ich vergleiche das gern mit Sprache:
Man lernt Grammatik, um sich verständlich auszudrücken – aber beim Reden denkt keiner mehr an Grammatik.
So sollte es auch beim Tango sein: Wir lernen Technik, damit wir frei tanzen können.
Das Ziel: Tanzen, nicht funktionieren
Am Ende geht es nicht um perfekte Bewegungen, sondern um authentisches Tanzen. Wenn die Musik dich wirklich erreicht, erledigt sich vieles von selbst – die Haltung richtet sich, die Schritte finden ihren Platz, der Körper reagiert spontan und lebendig.
Darum sage ich manchmal, wenn jemand sich zu sehr auf Technik konzentriert:
„Hör auf zu denken – hör lieber zu.“
Denn Tanzen ist keine Prüfung. Es ist ein Gespräch mit der Musik. Und wer zuhört, tanzt immer besser.
Fazit
Am Ende geht es beim Lernen im Tango immer darum, eingeschliffene Muster zu erkennen und schrittweise zu verändern. Das braucht Zeit, Geduld und Aufmerksamkeit. Technik und Übungen sind nur Hilfsmittel, um diese Veränderungen bewusst zu machen – aber der eigentliche Wandel passiert im Kopf und im Körper zugleich.
Wenn wir beginnen, uns selbst beim Tanzen zuzuschauen, wahrzunehmen, was automatisch passiert, und kleine Dinge bewusst anders zu machen, entsteht langsam etwas Neues.
Es ist kein großer Moment, kein plötzlicher Durchbruch – eher ein allmähliches Verschieben von Gewohnheiten, bis sich ein neues Gleichgewicht einstellt. Und genau das ist der spannendste Teil des Lernens: zu merken, dass Veränderung möglich ist, auch in den kleinsten Bewegungen.
Epilog: Wenn ich von ehemaligen Tangoschülern ein Lob für meinen Unterricht bekomme, dann meisten mit dem Hinweis, dass sie mir meine Hartnäckigkeit für „Basics“ danken, die ihnen letztendlich zum Erfolg auf der Tanzpiste verholfen hat.
Also kann Beharrlichkeit auch sehr wichtig sein, um Menschen zu einem guten Tango zu verhelfen.