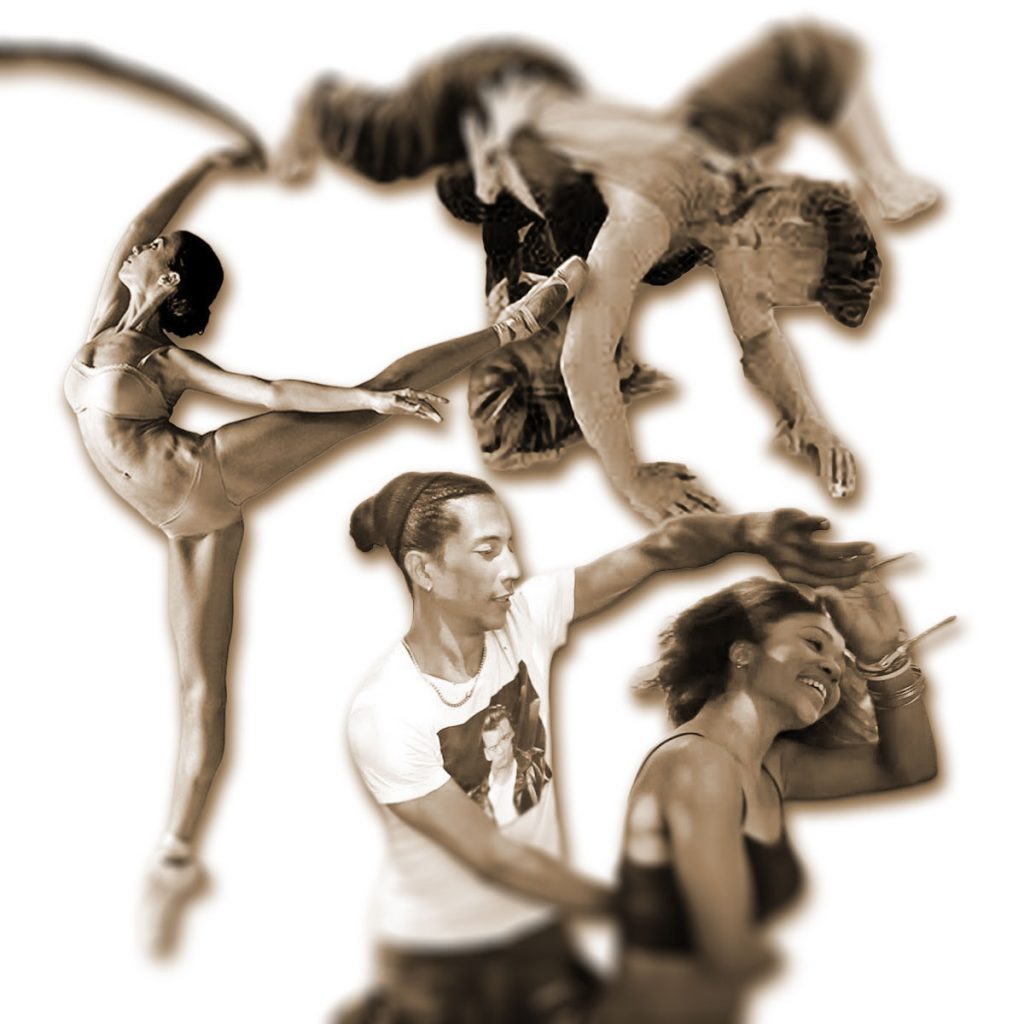
Was ist Tanz? Und was macht den Tango zum Tango?
Man urteilt schnell. Ein Blick auf ein Tango-Video – und schon fällt das Urteil: „Das ist kein Tango!“ Oder, ebenso entschieden: „Genau das ist es!“ Doch woran messen wir das? An der Form, an der Mode, an bestimmten Schritten? Vielleicht lohnt sich ein genauerer Blick: Was ist eigentlich Tanz? Und wann darf sich der Tango Tango nennen?
Diesen Fragen möchte ich in einem zweiteiligen Text nachgehen – jenseits von Stilrichtungen und Schrittfolgen, näher am Kern der Bewegung:
Teil 1: Was ist Tanz? – eine begriffliche und philosophische Erkundung
Teil 2: Was macht den Tango zum Tango? – eine vertiefte Anwendung auf das konkrete Beispiel
Ich bin beim Nachforschen zu diesem Thema auf Betrachtungen gestoßen, die mit einem Bild über den Tanz zunächst auch meine Vorstellung Tango ziemlich ins wanken gebracht haben. Ich wage diese Betrachtungen als selbstkritische Auseinandersetzung mit meinen Vorurteilen und bestimmten Aussagen, die man oft in der Tango-Szene hört, auch von wirklichen Könnern.
Die Frage bleibt: Gilt die freie Auslegung „was Tanz eigentlich alles sein kann“ auch bei der Festlegung „was Tango alles sein muss, um Tango zu sein“?
Teil 1: Was ist Tanz?
Wie viele Tänze gibt es eigentlich?
Tausende. Vielleicht sogar zehntausende – je nachdem, wie man zählt. In jeder Kultur, zu jeder Zeit, zu jedem Anlass ist getanzt worden. Und überall sieht das anders aus.
- Es gibt Gesellschaftstänze wie Standard, Latein, Volkstanz, Tango oder Salsa – Tänze, die Menschen zusammenbringen, oft mit klaren Regeln und Formen.
- Dann die künstlerischen Tänze, wie Ballett, Moderner Tanz oder Contemporary – dort geht es um Ausdruck, Emotion, oft auch um das Brechen von Regeln.
- Es gibt rituellen Tanz, religiös, schamanisch oder volkstümlich – Bewegungen, die aus Glauben, Gemeinschaft oder Tradition entstehen.
- Und schließlich die urbanen Tänze: Hip-Hop, Breakdance, House, Krumping – Formen, die aus der Straße kommen, aus dem Alltag, aus dem Wunsch, sichtbar zu werden.
All diese Tänze unterscheiden sich stark – in Musik, Technik, Stil, Energie.
Aber sie haben etwas gemeinsam: Sie sind bewusste Bewegung, die Bedeutung trägt. Bewegung, die mehr will, als nur von A nach B zu kommen. Egal, ob es darum geht, Gefühle zu zeigen, Geschichten zu erzählen, sich auszudrücken oder einfach Spaß zu haben – der Tanz entsteht immer dann, wenn der Körper etwas meint. Wenn man versucht, den Begriff Tanz zu fassen, merkt man schnell: so einfach ist das gar nicht.
Es gibt unzählige Formen, Stile, Anlässe. Tanz kann Ausdruck, Begegnung, Feier oder einfach Bewegung sein. Manche tanzen auf Bühnen, andere im Wohnzimmer, manche nur im Kopf. Schon ein Kind, das zur Musik herumhüpft, tanzt – und vielleicht auch jemand, der sich in der Küche im Rhythmus eines Liedes wiegt, ohne es zu merken.
Vielleicht beginnt Tanz genau dort: wenn Bewegung bewusst wird.
Wenn der Körper nicht einfach nur „funktioniert“, sondern etwas ausdrückt. Etwas, das man mit Worten gar nicht sagen könnte. Oft wird gesagt, Tanz brauche Musik, Rhythmus, Form. Das stimmt – manchmal. Aber nicht immer. Es gibt Tänze, die ganz ohne Musik entstehen. Tänze, die in der Stille geboren werden. Der Körper hat ja seinen eigenen Rhythmus: Atmung, Herzschlag, Gewicht. Manchmal reicht das schon völlig.
Und natürlich gibt es Tänze mit strengen Regeln – Standard, Latein, Ballett – und solche, die völlig frei sind – zeitgenössischer Tanz, Improvisation, Contact.Beides ist Tanz. Die einen folgen einer klaren Struktur, die anderen folgen dem Moment. Entscheidend ist nicht die Form, sondern die Haltung: das Bewusstsein, dass da gerade etwas passiert, das über reines Bewegen hinausgeht. Vielleicht ist Tanz einfach eine Art Kommunikation – mit sich selbst, mit der Musik, mit dem Raum, mit anderen Menschen. Eine Sprache ohne Worte. Wenn zwei Menschen tanzen, entsteht ein Gespräch aus Bewegung. Wenn man allein tanzt, ist es ein Gespräch mit der eigenen Stimmung, mit der Musik oder mit der Stille.
Man könnte sagen: Tanz ist eine der ehrlichsten Formen von Ausdruck. Weil man sich nicht verstecken kann. Weil der Körper immer die Wahrheit sagt. Viele meinen, Tanz müsse „richtig“ sein. Aber was heißt das überhaupt? Richtig für wen? Nach welchem Maßstab?
Tanz hat keine allgemeingültige Definition. Er entsteht da, wo Bewegung Bedeutung bekommt – und jemand sie wahrnimmt. Vielleicht kann man es so sagen: Tanz ist Bewegung, die man fühlt – im Körper, im Kopf, im Herz. Er braucht keine Bühne, keine Zuschauer, nicht einmal Musik. Nur Bewusstsein. Nur dieses kleine Innehalten, in dem Bewegung plötzlich Sinn bekommt.
Thomas Hauert „inaudible“
Freier Improvisationstanz
Zusammenfassung: Was ist Tanz?
- Bewegung als Ausdruck: Tanz ist eine der ältesten Ausdrucksformen des Menschen. Er kann rituell, künstlerisch, sozial oder rein körperlich sein.
- Definition: Tanz lässt sich schwer eindeutig definieren – ist er Bewegung im Rhythmus? Ist er Kommunikation über den Körper?
- Philosophische Perspektive: Tanz ist verkörperte Bedeutung – Bewegung, die etwas meint.
- Grenzfälle: Wenn jemand sich bewegt, ohne Musik – oder wenn die Bewegung zufällig oder unbewusst ist – ist das schon Tanz? (z. B. Performance-Kunst, improvisierter Ausdruckstanz, Alltagsbewegungen als Tanz)
Muss Tanz bestimmte Vorgaben erfüllen?
- In traditionellen oder gesellschaftlichen Tänzen gibt es klare Strukturen (Schritte, Takte, Figuren).
- In moderner Tanzkunst (z. B. Pina Bausch, Merce Cunningham) dagegen wird das Konzept oft aufgelöst.
- Fazit: Tanz kann Form haben – muss aber nicht. Entscheidend ist oft die Intention oder Rahmung.
Übergang zu Teil 2
Es gibt viele Leute, die mit dieser freien Auslegung des Begriffs „Tanz“ auch den „Tango als Improvisationstanz auf recht wacklige Beine stellen möchten, denn wenn Tanz so vieles sein kann – frei oder geregelt, laut oder leise, wild oder ganz ruhig –, dann stellt sich automatisch die Frage:
Wie ist das beim Tango?
Muss er bestimmte Regeln erfüllen, um „Tango“ zu heißen? Oder reicht es, wenn sich zwei Menschen einfach in der Musik begegnen?
Teil 2: Was macht den Tango zum Tango?
Über den Tango wird ja gern gestritten. „Das ist kein richtiger Tango!“, sagen die einen. „Doch, genau so soll er sein!“, sagen die anderen. Und irgendwo dazwischen tanzen Menschen, die gar nichts beweisen wollen – sie tanzen einfach. Aber was macht ihn denn nun wirklich aus, diesen Tango?
Tango ist viel mehr als ein Tanzstil. Er ist eine ganze Welt: Musik, Geschichte, Haltung, Gefühl. Er ist in Buenos Aires entstanden, aus vielen Einflüssen – europäischen Melodien, afrikanischen Rhythmen, der Sehnsucht der Einwanderer. Deshalb trägt er so viele Gegensätze in sich: Nähe und Abstand, Spannung und Zärtlichkeit, Freiheit und Struktur.
Das Entscheidende im Tango ist die Begegnung.
Oft wird deshalb der Tango mit der Contact Improvisation verglichen, und auf den ersten Blick gibt es Parallelen: Auch dort entsteht Bewegung spontan, im Moment, durch Gewicht, Gleichgewicht und Reaktion. Aber der entscheidende Unterschied liegt in zwei Punkten. Erstens: Bei der Contact Improvisation gibt es in der Regel keine Musik – die Orientierung erfolgt rein über Körperkontakt und Impuls. Im Tango dagegen ist die Musik der dritte Partner. Sie gibt Struktur, Dynamik und Atmosphäre vor. Die Tänzer reagieren nicht nur aufeinander, sondern gemeinsam auf die Musik.
Zweitens: In der Contact Improvisation wechseln die Partner oft, es entsteht ein freier Raum mit vielen Begegnungen. Im Tango dagegen bleibt das Paar zusammen – zwei Menschen teilen eine Umarmung, hören dieselbe Musik, bewegen sich gemeinsam in der Ronda, also im Fluss der anderen Paare auf der Tanzfläche. Es ist ein soziales Miteinander, aber kein offenes Gruppengeschehen.
Wenn man es schlicht ausdrückt, könnte man sagen: Tango ist eine Form von Contact Improvisation – im aufrechten Gang, in einer festen Umarmung, zur Musik, mit sozialer Ordnung und klaren Rollen.
Natürlich hat der Tango auch seine Regeln: die Umarmung, die Haltung, die gemeinsame Achse, die Bewegung im Kreis, das Zuhören auf die Musik. Aber diese Regeln sind eher wie eine gemeinsame Sprache. Sie sollen nicht einschränken, sondern Verständigung ermöglichen. Was man dann „sagt“, entsteht jedes Mal neu.
Und dann gibt es noch die Rollen – Führende und Folgende. Das ist kein Machtgefälle, sondern eine Aufgabenteilung. Der Führende gibt meist die Richtung, den Raum und oft auch die musikalische Interpretation vor. Er organisiert nicht nur den eigenen Tanz, sondern achtet gleichzeitig auf die Ronda, also auf den Fluss der Tanzenden auf der Piste. Die Folgende dagegen bezieht sich räumlich fast nur auf ihren Partner. Sie hat ihren eigenen Einfluss – aber eben innerhalb des gemeinsamen Rahmens. Wenn der Führende Raum lässt, kann sie die Musik auf ihre Weise interpretieren, Akzente setzen, Nuancen gestalten. Und genau da beginnt der Zauber: in diesem Wechselspiel von Führen und Folgen, von Geben und Antworten, von Struktur und Freiheit.
Darum ist auch die Frage, ob nur improvisierter Tango der „echte“ Tango ist, gar nicht so leicht zu beantworten. Ein choreografierter Bühnentango kann genauso ehrlich und lebendig sein – wenn zwischen den Tänzern echte Verbindung entsteht. Und umgekehrt kann ein improvisierter Tango leer wirken, wenn beide nur Schritte machen, ohne aufeinander zu hören.
Am Ende zählt die Haltung, nicht die Form. Tango ist kein festes System, sondern eine Art, miteinander umzugehen. Kein Wettbewerb, sondern Kommunikation. Ob auf der Bühne, in der Milonga oder zu Hause im Wohnzimmer – Tango passiert, wenn zwei Menschen wirklich da sind: füreinander, mit der Musik, im Moment.
Aber! Über Qualität im Tango
Frage: Entscheidet die tänzerische Qualität darüber, ob jemand wirklich Tango tanzt?
Wenn man jetzt alles zusammenfasst, könnte man fast meinen, jede Arbeit an der eigenen Technik oder am tänzerischen Ausdruck sei überflüssig – solange sich zwei Menschen irgendwie in einer Umarmung bewegen.Zählen Musikalität, Eleganz und Ausdruck denn gar keine Rolle?
Ich höre hier schon einige Free-Style-Apologeten jubeln: „Na also! Dann ist es ja egal, was ich tue – warum also überhaupt Arbeit in den Tanz stecken?“
Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn ohne eine gewisse Bewegungsqualität verliert der Tango seine Tiefe. Die Verbindung zwischen zwei Tänzern entsteht ja nicht nur durch Nähe, sondern auch durch Können, Bewusstsein und Körpergefühl. Wenn Haltung, Balance, Entspannung, Musikalität oder das Zuhören in der Umarmung fehlen, dann ist es vielleicht immer noch Bewegung – aber kein Tango mehr im eigentlichen Sinn.
Tango lebt von Feinheit, von innerer und äußerer Qualität. Nicht im Sinne von Perfektion oder Show, sondern von Klarheit.
Wenn man den Körper entspannt, die Achse spürt, die Musik atmet – dann wird aus einem Schritt eine Sprache. Dann trägt jede Bewegung Bedeutung, jeder Atemzug erzählt etwas. Und das Publikum – oder der Tanzpartner – spürt sofort den Unterschied. Natürlich ist niemand perfekt, und Tango ist keine sportliche Disziplin. Aber wie in jeder Kunstform gehört zum Ausdruck auch das Handwerk.
Musikalität, Technik, Eleganz – sie sind keine Gegner der Emotion, sondern ihre Träger.
Erst wenn man das Werkzeug beherrscht, kann man wirklich frei werden.Ein schlecht getanzter Tango ist nicht „falsch“, er ist einfach unausgesprochen. Wie ein Gespräch, bei dem einer den anderen nicht richtig versteht, weil die Worte fehlen oder zu laut sind. Wenn man aber die Sprache verfeinert – durch Haltung, Rhythmus, Musikalität –, dann wird der Dialog klarer, ehrlicher, berührender.
Man könnte also sagen: Tango entsteht aus Verbindung – aber Qualität hält diese Verbindung lebendig. Am Ende zählt beides: das Herz und das Handwerk, Gefühl und Können, Nähe und Bewusstheit. Ohne Technik bleibt die Bewegung roh. Ohne Gefühl bleibt sie leer.
Tango braucht beides – und genau darin liegt seine Schönheit
Für mich nun zum wichtigsten Teil des Tangos:
Über Musik und Interpretation
Und da ist da noch was, das oft vergessen wird: die Musik.
Ohne Musik gibt’s keinen Tango. Punkt.
Aber was heißt das eigentlich – zur Musik tanzen?
Es geht nicht darum, einfach nur im Takt zu bleiben.
Musikalität im Tango heißt, die Musik wirklich zu hören.
Nicht nur die Melodie, sondern auch die Pausen, die Betonungen, die kleinen Überraschungen. Die Musik gibt die Stimmung vor – und der Tänzer oder die Tänzerin reagiert darauf. So entsteht dieser Dialog zwischen Bewegung und Klang, der den Tango lebendig macht.
Musik ist im Tango nie Nebensache. Sie ist wie ein dritter Partner.
Wenn sie sich verändert, verändert sich auch der Tanz. Ein Di Sarli klingt anders als ein D’Arienzo, ein Troilo anders als ein Pugliese – und bei Piazzolla wird’s richtig spannend, weil seine Musik ständig springt, bremst, beschleunigt.
Ist es also ok, wenn man bei Piazzolla mal neben der Musik tanzt?
Kommt drauf an.
Wenn man’s bewusst macht, weil man eine Pause setzen will oder weil die Musik dazu einlädt – klar, das kann sogar spannend sein.
Aber wenn man die Musik einfach ignoriert, verliert der Tango seinen Kern.
Dann bewegt man sich zwar, aber man tanzt nicht zur Musik, sondern einfach dagegen.
Musikalität heißt nicht, dass jeder Schritt perfekt im Takt ist.
Es heißt, dass das, was man tanzt, zur Musik passt.
Dass Bewegung und Klang zusammen Sinn ergeben.
Manchmal ist das ein Schritt, manchmal nur ein Atemzug – aber man bleibt im Gespräch mit der Musik.
Zuhören, reagieren, mitschwingen.
Nicht stur tanzen, sondern verstehen, was die Musik will – und dann darauf antworten.
Zusammenfassung:
a) Der Tango als Tanzform
- Argentinischer Tango (im Gegensatz zu Standard-Tango) ist ein Improvisationstanz.
- Er entsteht aus der Kommunikation zwischen Führendem und Folgendem.
- Er hat bestimmte ästhetische Prinzipien (z. B. Umarmung, musikalische Phrasierung, Achse, Verbindung).
- Er braucht also keine festen Figuren, sondern gemeinsame Sprache und Achtsamkeit.
b) Der Tango als Kultur
- Entstanden in Buenos Aires aus Einflüssen vieler Kulturen (afrikanisch, europäisch, kreolisch).
- Musik, Tanz und Haltung bilden eine untrennbare Einheit.
- Tango ist auch soziale Praxis: Milonga, Rollenverteilung, Codes („cabeceo“, Einladung, Etikette).
c) Wann ist ein Tango kein Tango mehr?
- Wenn er z. B. nur Show ist? Oder wenn die Verbindung fehlt?
- Wenn Musik keine Rolle spielt?
- Vielleicht dann, wenn die Kommunikation zwischen zwei Menschen nicht mehr im Mittelpunkt steht.
Fazit
Bei aller Freiheit, Tanz als Tanz zu sehen oder jede Bewegung irgendwie als Tanz zuzulassen – beim Tango ist das nicht ganz so frei auslegbar.
Tango hat seine eigene Sprache, und die bringt bestimmte Grundlagen mit sich: Haltung, Musikalität, Verbindung, Klarheit.
Wenn diese Dinge fehlen, wird aus Tango schnell nur Bewegung mit Musik.
Trotzdem fühlen sich manche – gerade im Bereich des sogenannten Tango-Freestyles – dazu ermutigt, die Dehnbarkeit des Begriffs „Tanz“ auch auf den Tango zu übertragen.
Und natürlich: Tango ist Tanz, keine Frage.
Aber die Grenzen sind hier einfach etwas enger gesteckt.
Wie eng genau, das steht mir nicht zu, zu beurteilen – doch man spürt, wenn sie überschritten werden.
Das heißt nicht, dass alles perfekt sein muss.
Aber ein gewisses Maß an Bewusstheit, an Gefühl für Musik, Raum und Partner, gehört einfach dazu.
Tango lebt von dieser Mischung aus Technik und Gefühl, aus Freiheit und Form.
Nur wenn beides zusammenkommt, entsteht das, was wir alle suchen: ein Moment, der echt ist – und trotzdem nach Tango aussieht.
Ansonsten würde der Tango vielleicht so aussehen: